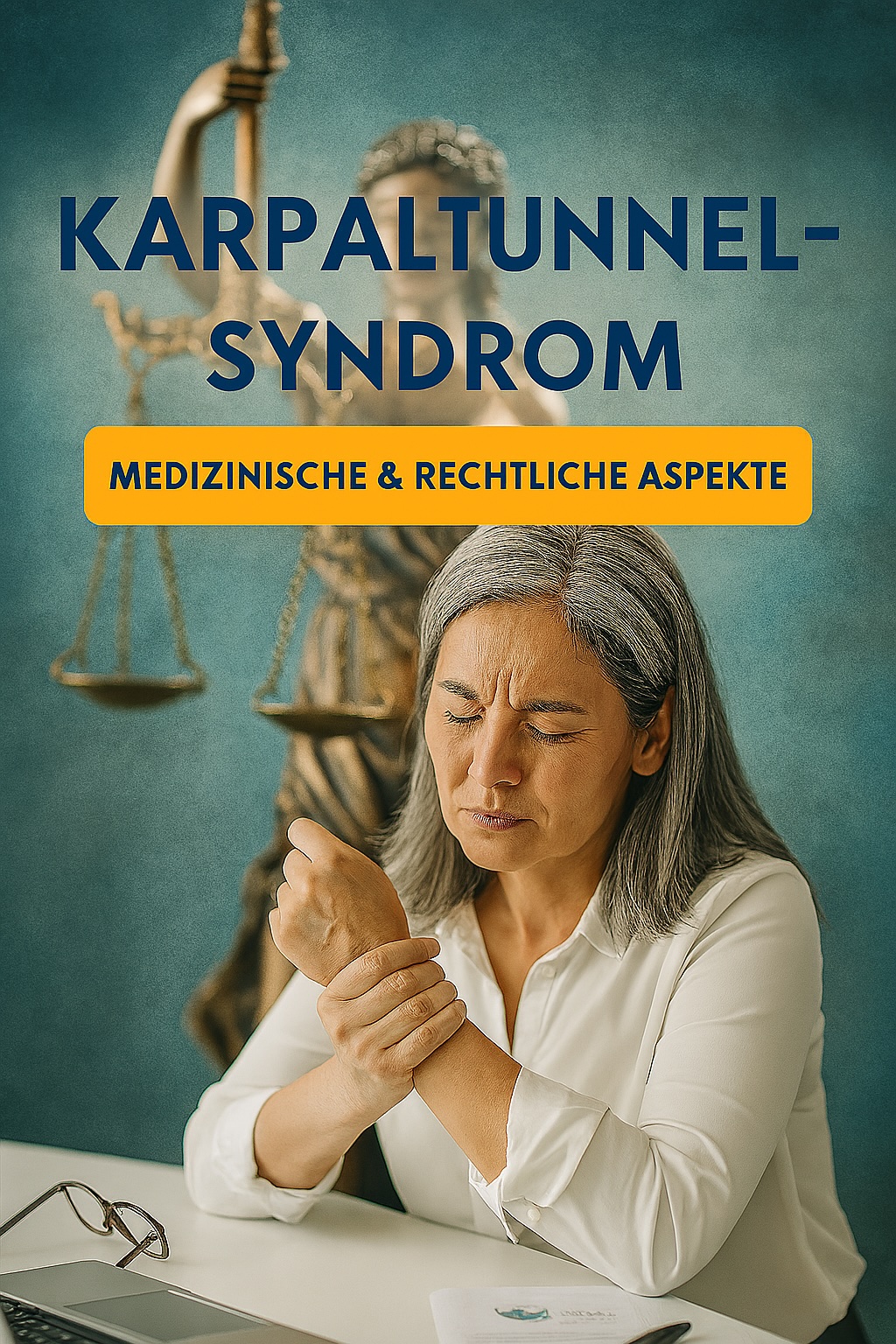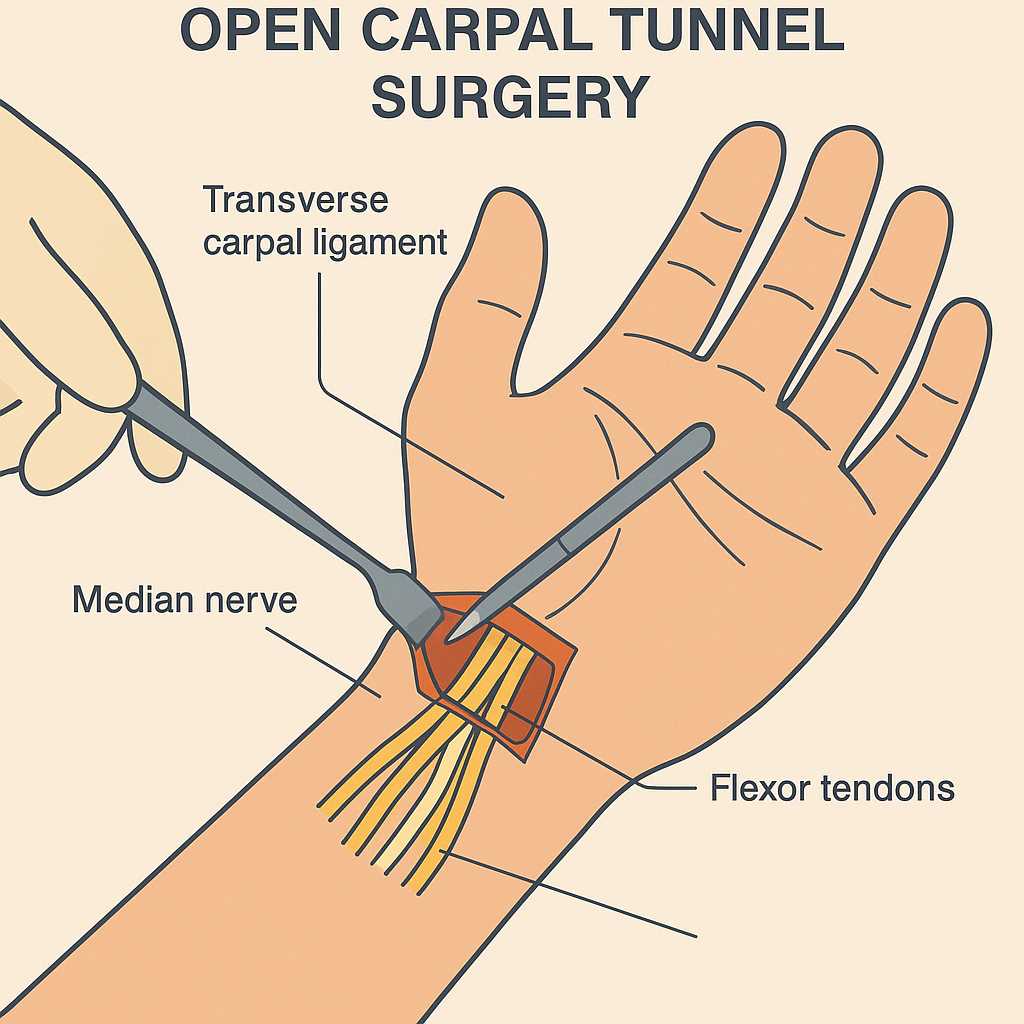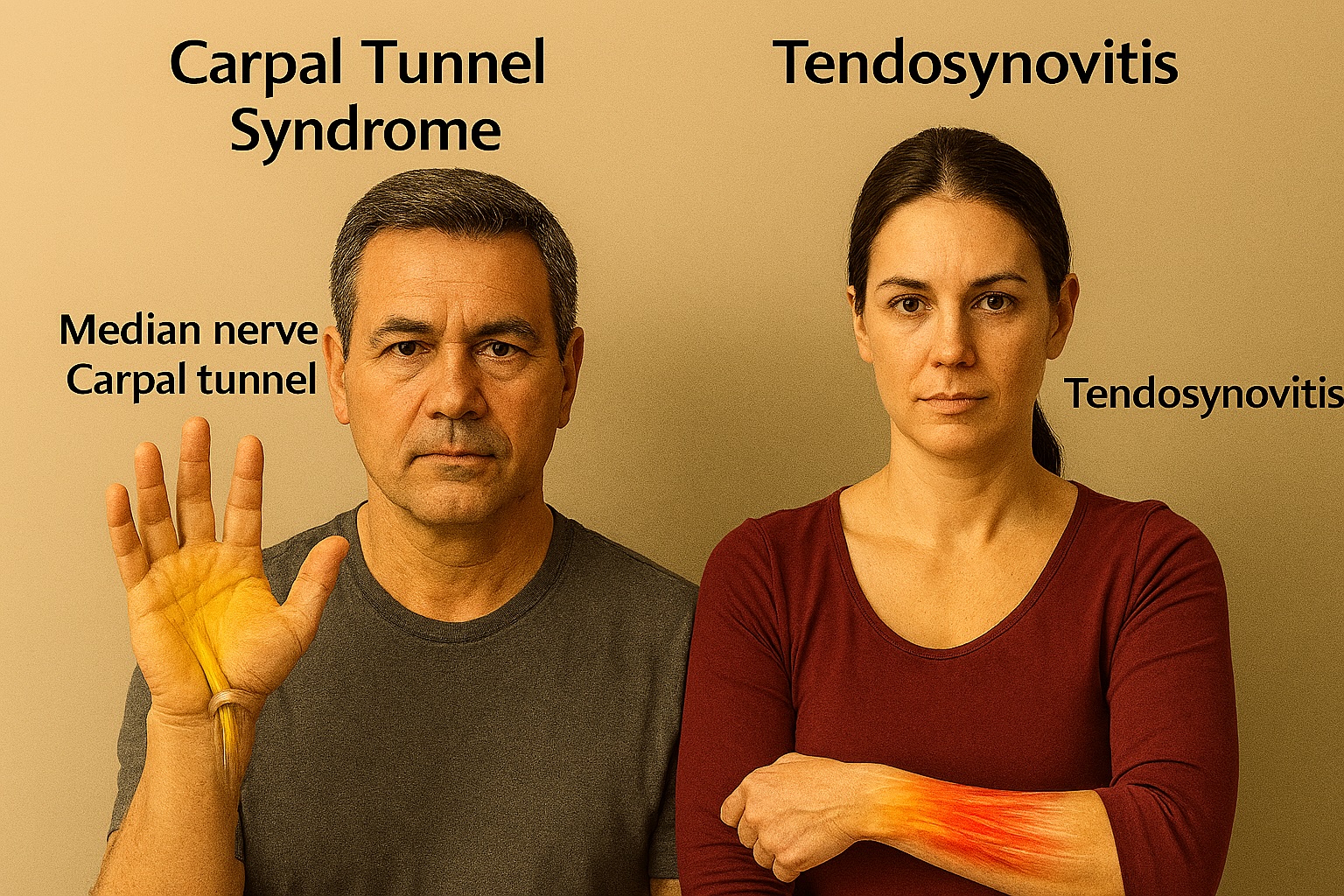Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist mehr als nur ein medizinisches Problem, es kann auch arbeitsrechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen haben. Daher sollten Betroffene nicht nur auf die Symptome achten, sondern auch wissen, welche Ansprüche gegenüber Krankenkasse, Arbeitgeber und Versicherung bestehen.
Anerkennung als Berufskrankheit?
Das Karpaltunnelsyndrom ist zwar nicht offiziell als Berufskrankheit anerkannt, aber wenn die Krankheit durch langjährige belastende manuelle Tätigkeiten (z. B. Fließbandarbeit, Montage, Büroarbeit) oder einen Arbeitsunfall verursacht ist, übernimmt die AUVA teilweise die Behandlung- und Rehakosten. Die Meldung an die AUVA kann durch den Arzt oder den Arbeitgeber erfolgen.
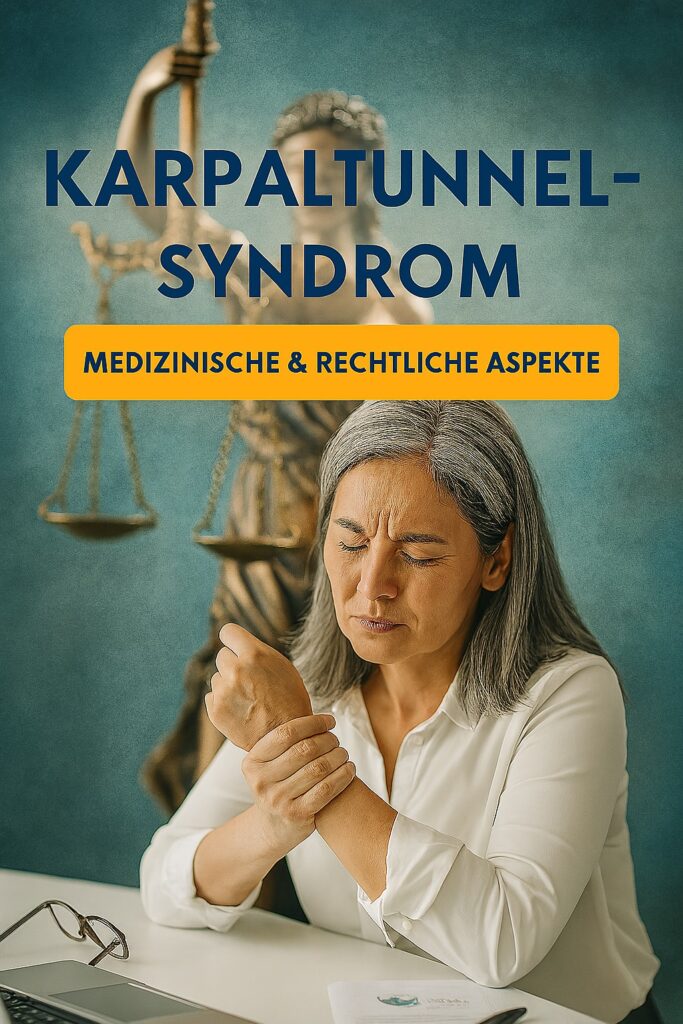
Arbeitgeberpflichten bei Karpaltunnelsyndrom
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung: Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitsplätze gesundheitsgerecht zu gestalten.
- Gefährdungsbeurteilung: Bei Beschwerden prüft der Arbeitgeber, ob es andere Möglichkeiten gibt, der Arbeit adäquat nachzukommen.
- Betriebsarzt & Prävention: Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitenden müssen arbeitsmedizinische Betreuung sicherstellen. Unter 10 Mitarbeitern können sich Arbeitgeber für eine Art vereinfachte sicherheitstechnische Betreuung anmelden, z.B. über die AUVA.
Krankenkasse & Kostenübernahme
Was zahlt die Krankenkasse?
- Diagnostik: EMG, Ultraschall, MRT, in der Regel übernommen.
- Therapie: Schienen, Medikamente, Physiotherapie, meist Kassenleistung, manchmal mit Eigenanteil.
- Operation: In der Regel Übernahme der Kosten, wenn konservative Methoden nicht anschlagen, aber bei einem Wahlarzt oder einer Privatklinik muss man die Kosten selbst tragen, teilweise Rückerstattung möglich.
Tipp:
Private Zusatzversicherungen können zusätzliche Leistungen wie ambulante OPs oder alternative Therapien (z. B. Hydrodissektion mit Hyaluronsäure) abdecken.
Arbeitsunfähigkeit und Lohnfortzahlung
Krankschreibung mit der sogenannten „AU“ (Arbeitsunfähigkeitsmeldung)
Die Lohnfortzahlung richtet sich nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit:
Ab 1 Jahr: 8 Wochen volle Lohnfortzahlung plus 4 Wochen halbes Gehalt
Besteht 15 Jahre Betriebszugehörigkeit: 10 Wochen volle Lohnfortzahlung plus 4 Wochen halbes Gehalt
Ab 25 Jahren: 12 Wochen volle Lohnfortzahlung plus 4 Wochen halbes Gehalt
Nach dieser Zeit gibt es Krankengeld von der Krankenkasse. Das Geld fließt so lange, wie eine ärztlich bestätigte Arbeitsunfähigkeit besteht (innerhalb der gesetzlichen Maximaldauer).

Reha & Wiedereingliederung bei Karpaltunnelsyndrom
Nach längerer Erkrankung kann eine stufenweise Wiedereingliederung sinnvoll sein, daher gibt es seit 2017 das Modell der „Wiedereingliederungsteilzeit“ (WIETZ). Hierbei ist die Arbeitszeit für 1-12 Monate reduziert und der Arbeitnehmer bekommt ein Teilzeitgehalt. Der Betriebsarzt kann Empfehlungen für ergonomische Arbeitspaltzgestaltung geben und der Arbeitsinspektionsdienst achtet auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Rechtliche Stolperfallen
- Arbeitnehmer müssen unverzüglich melden, wenn sie arbeitsunfähig sind, versäumt der Patient die Meldung oder bringt sie zu spät, kann das eine Kürzung oder den Verlust der Entgeltfortzahlung zur Folge haben.
- Nach Ablauf der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber, zahlt die Krankenkasse Krankengeld. Wer zu spät die AU-Meldung bei der Krankenkasse einreicht, riskiert eine Lücke beim Krankengeld.
- Wiedereingliederungszeit (WIETZ), Voraussetzung sind mindestens 6 Wochen durchgehender Krankenstand und Zustimmung von Arbeitgeber und Krankenkasse. Vorsicht, Arbeitgeber kann ablehnen. Die Vereinbarung muss schriftlich sein und bei der Krankenkasse eingereicht werden. Wenn der Krankenstand unterbrochen wird, kann das den Anspruch gefährden.
- Kündigung während oder nach der Krankheit möglich, da es keinen absoluten Kündigungsschutz gibt.
- Bekommt der Arbeitgeber keinen angepassten Arbeitsplatz, trotz ärztlicher Empfehlung, was leider häufig passiert, muss er sich selbst kümmern. Betriebsrat oder Arbeitsinspektion helfen hierbei.
- Private vs. Kasssenleistungen vorher abklären, damit keine ungeplanten Kosten auf den Patienten zukommen.
Checkliste für Arbeitnehmer mit Karpaltunnelsyndrom
- Ärztliche Diagnose schriftlich einholen und ein „Arbeitsunfall- bzw. Berufskrankenheitenverdacht“ dokumentieren lassen (Befunde und Atteste gut aufbewahren für Krankenkasse, AUVA und Arbeitgeber)
- Arbeitsmedizinische Betreuung kontaktieren und ergonomische Anpassungen in Anspruch nehmen sowie Gefährdungsbeurteilung erstellen lassen
- Krankenstand und Entgeltfortzahlung klären, „Arbeitsunfähigkeitsmeldung“ bei Arbeitgeber und Krankenkasse einreichen
- OP-Kosten werden von der Krankenkasse übernommen, Anspruch auf Reha besteht, falls es längerfristige Einschränkungen gibt, besteht die Möglichkeit der „beruflichen Reha“ über den Sozialministeriumservice (z.B. Umschulung, Arbeitsplatzanpassung)
Fazit: Medizin trifft Recht
Da das Karpaltunnelsyndrom nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein sozialrechtliches Thema sein kann, ist es gut, frühzeitig zu handeln. Eine gute Dokumentation, ärztliche Begleitung und das Wissen um die eigenen Rechte sind folglich entscheidend. Weitere interessante Infos zum Karpaltunnelsyndrom finden Sie hier: https://carpaltunnelsyndrom.at/karpaltunnelsyndrom-durch-schreibarbeit-eine-unterschaetzte-gefahr-im-bueroalltag/